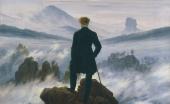Hans Holbein d. Ä.
Hans Holbein d. Ä.
Die Zeichnung gehört zu den frühen lavierten Federzeichnungen Holbeins, die meist als Reinzeichnungen oder Visierungen dienten. Charakteristisch für diese Blätter sind die exakte Federkonturierung und die Binnenlavierung zur Modellierung der Figuren und Draperien. Einzelne Linien wie Gewandfalten oder die Umrahmung der Rasenbank sind formelhaft mit dem Lineal gezogen, während der eigentliche Akzent auf die Gesten gelegt ist, etwa die gefalteten Hände des linken Engels oder das Anheben der Draperie durch den rechten Engel.
Schilling datierte das Blatt kurz vor 1500 und rückte es stilistisch in die Nähe der Weimarer „Madonna als Himmelskönigin“ (Anm. 1), die als Vorzeichnung für eine Goldschmiedearbeit gilt.(Anm. 2) Im Vergleich mit der Weimarer Zeichnung ist das Hamburger Blatt feiner ausgeführt und intimer im Charakter. Die Autorschaft Holbeins ist allgemein anerkannt, allein Krause erwähnt die Blätter – das Hamburger wie das Weimarer – als „Holbein zugeschriebene Zeichnungen“.(Anm. 3) Paecht hat dagegen beide Zeichnungen zur stilistischen Bestimmung der Miniaturen in der Simpertushandschrift angeführt, die er Holbein zuschreibt.(Anm. 4)
Die Hamburger Zeichnung hat vermutlich als Studie für ein verlorenes Gemälde gedient, das zeitlich den um 1495 und 1499 datierten Madonnenbildern in Nürnberg zuzuordnen wäre.(Anm. 5) Unser Blatt wird daher in diesen Zeitraum zu datieren sein.(Anm. 6) Am Beispiel der Nürnberger Tafeln hat Krause erläutert, wie Holbein niederländische Einflüsse mit oberdeutschen Motiven kombinierte.(Anm. 7) Dies kann auch für die Komposition der Hamburger Zeichnung gelten. So erinnert der Typus der Madonna an Memlings Madonnen (Anm. 8), während die Darstellung der Madonna auf der Rasenbank auf Martin Schongauers Stich (Bartsch 30) zurückgeht. Das Motiv der stillenden Madonna findet sich dagegen ähnlich auf einem Stich des Hausbuchmeisters, der um 1490 datiert wird.(Anm. 9)
Die in der Komposition verwandte Madonnendarstellung in Basel (Anm. 10) galt lange als Original Holbeins, später als Werkstattkopie nach der Hamburger Madonna.(Anm. 11) Auf Grund der Unterschiede in der Ausführung sah Landolt unsere Zeichnung zu Recht nicht als direkte Vorlage für das Basler Blatt an.(Anm. 12) Vielmehr werden beide Werke auf den gleichen Entwurf zurückgehen. Auch eine weitere „Madonna mit Engeln“ (Anm. 13) in Basel zeigt trotz ähnlicher Komposition wenig Gemeinsamkeiten mit unserer Zeichnung. Das Basler Blatt wurde früher Martin Schaffner zugeschrieben und gilt heute ebenfalls als Werkstattarbeit.
Petra Roettig
1 Schilling 1929, S. 14–15, Abb; Schilling 1933, S. 316–318, Abb. Die Zeichnung ist bei Norbert Lieb, Alfred Stange: Hans Holbein der Ältere, Augsburg 1960 nicht erwähnt.
2 Weimar, Klassik Stiftung Weimar und Kunstsammlungen, Graphische Sammlung, Inv.-Nr. KK 127, vgl. Zeichnungen deutscher und Schweizer Künstler des 15. und 16. Jahrhunderts, Ausst.-Kat. Weimar 1986, S. 79, Nr. 69, Abb.
3 Krause 2002, S. 57–59, Abb. 51 und 52.
4 München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 30044, f. 1v und f. 39v, vgl. Paecht 1964, S. 24, Abb; Krause 2002, S. 76–78, Abb.
5 Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, Inv.-Nrn. Gm 273 und Gm 279, vgl. Germanisches Nationalmuseum Nürnberg. Die Gemälde des 16. Jahrhunderts, bearbeitet von Kurt Löcher unter Mitarbeit von Carola Gries, Stuttgart 1997, S. 275–280, Abb; Krause 2002, S. 79-85, Taf. IV und V, S. 198 und 199. Die Datierung des Madonnenbildes um 1495 (Gm 279) nach Krause 2002, S. 80 und Anm. 148. Löcher, S. 279 datiert die Tafel dagegen um 1502.
6 Landolt in Ausst.-Kat. Augsburg 1965, S. 102, Nr. 65, Abb. 67, setzt die Hamburger Zeichnung in die Frühzeit; Konrad 1990, S. 62, Taf. IX datiert das Blatt um 1495 auf Grund der Nähe zur Unterzeichnung der Donaueschinger Tafel der „Geburt Christi“, um 1494, Fürstlich Fürstenbergische Kunstsammlungen, Inv.-Nr. 121.
7 Krause 2002, S. 79-85.
8 Vgl. die Berliner Madonna, um 1480–90, Staatliche Museen, Inv.-Nr. 529 oder die „Thronende Madonna mit Kind“, um 1492–94, Granada, Capilla Real, vgl. Dirk de Vos: Hans Memling. Das Gesamtwerk, Stuttgart, Zürich 1994, S. 217–219, Nr. 54, Abb. und S. 330, Nr. 91, Abb.
9 Vgl. Vom Leben im späten Mittelalter. Der Hausbuchmeister oder Meister des Amsterdamer Kabinetts. Ausst.-Kat. Frankfurt am Main 1985, S. 104, Nr. 27, Abb.
10 Basel, Kunstmuseum, Kupferstichkabinett, Inv.-Nr. U. III. 66, vgl. Falk 1979, S. 87, Nr. 188, Taf. 54.
11 Vgl. Ausst.-Kat. Augsburg 1965, S. 114, Nr. 95.
12 Hanspeter Landolt: Die Zeichnungen Hans Holbeins des Älteren, Versuch einer Standortbestimmung, Habil. Schrift (ungedruckt), Basel 1961, S. 62, vgl. Falk 1979, S. 87, Nr. 188.
13 Basel, Kunstmuseum, Kupferstichkabinett, Inv.-Nr. U. III. 38a, vgl. Falk 1979, S. 94, Nr. 229, Taf. 60.
Details zu diesem Werk
Beschriftung
Provenienz
Georg Ernst Harzen (1790-1863), Hamburg (L. 1244), NH Ad: 01: 04, fol. 142: "Fünfzehntes Jahrhundert 2te Hälfte Schule von Colmar Auf einer von Planken zusamgehaltenen Rasenbank sitzend, reicht Maria dem Kind die Brust; ihr Gewand in trefflichen Falten gelegt, bedeckt die Füße die auf einem Kissen ruhen. {Neben den beyden kniet ein weiterer} An einer Seite erscheint ein kniender Engel im {...} Gebet an die Jungfrau {neben} während ein anderer gegenüber ihren weiten Mantel zurechtlegt. Feder und Tuschzeichnung von großer Schönheit und tiefer Empfindung. 7.3.8.0 Restauriert", am Rand: "ob BFM !"; und Ad: 02: 01, S. 239; Legat Harzen 1863 an die „Städtische Gallerie“ Hamburg; 1868 der Stadt übereignet für die 1869 eröffnete Kunsthalle
Bibliographie
Peter Prange: Deutsche Zeichnungen 1450-1800. Katalog, Die Sammlungen der Hamburger Kunsthalle Kupferstichkabinett, Bd. 1, Köln u.a. 2007, S.184-185, Nr.387, Abb.Farbtafel S. 46
Katharina Krause: Hans Holbein der Ältere, München 2002, S.57-59, Abb.51
Petra Roettig, Annemarie Stefes, Andreas Stolzenburg: Von Dürer bis Goya. 100 Meisterzeichnungen aus dem Kupferstichkabinett der Hamburger Kunsthalle, Ausst.-Kat. Hamburger Kunsthalle 2001, S.128-129, Nr.59, Abb.
Von Dürer bis Baselitz. Deutsche Zeichnungen aus dem Kupferstichkabinett der Hamburger Kunsthalle, Ausst.-Kat. Hamburger Kunsthalle 1989, S.14-15, Abb, Nr.3
Die Fürstenbergsammlungen Donaueschingen: Altdeutsche und schweizerische Malerei des 15. und 16. Jahrhunderts, Claus Grimm, Bernd Konrad, 1989, S.61-62, Nr.Nr. VII.I, Abb.62
Tilman Falk: Katalog der Zeichnungen des 15. und 16. Jahrhunderts im Kupferstichkabinett Basel. Teil 1: Das 15. Jahrhundert, Hans Holbein der Ältere und Jörg Schweiger, die Basler Goldschmiederisse, Basel, Stuttgart 1979, S.87, Nr.bei Nr. 188
Hans Holbein der Ältere und die Kunst der Spätgotik, Ausst.-Kat. Rathaus, Augsburg 1965, S.102, Nr.65, Abb.Taf. 67
Otto Pächt: Vita Sancti Simperti. Eine Handschrift für Maximilian I., Berlin 1964, S.24, Abb.12 a
Handzeichnungen deutscher Meister von Dürer bis Menzel anlässlich der Zehnjahresfeier des japanisch-deutschen Kulturinstituts Tokyo, Ausst.-Kat. Tokyo 1937, Tokyo 1937, Nr.24, Abb.
Edmund Schilling: Zur Zeichenkunst des älteren Holbein, in: Pantheon XII, 1933, S. 315-322, S.315-322, Abb.315
Edmund Schilling: Hans Holbein the Elder - The Virgin and Child, in: Old Master Drawings IV, London 1929-30, Nr. 13, S. 14-15, S.14 - 15, Abb.Plate 17